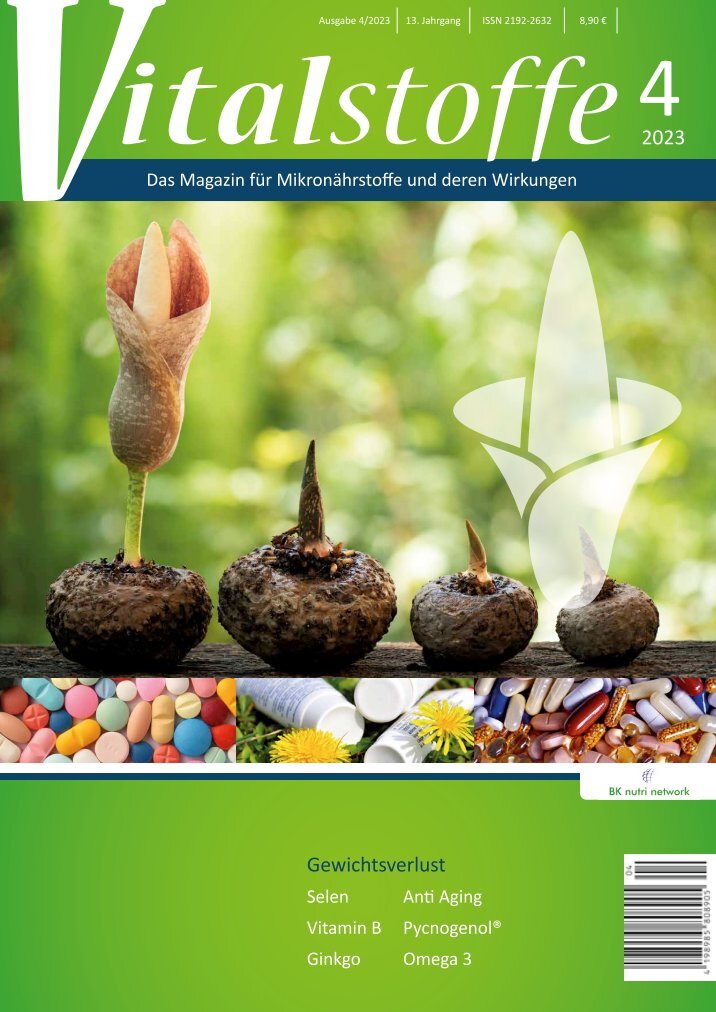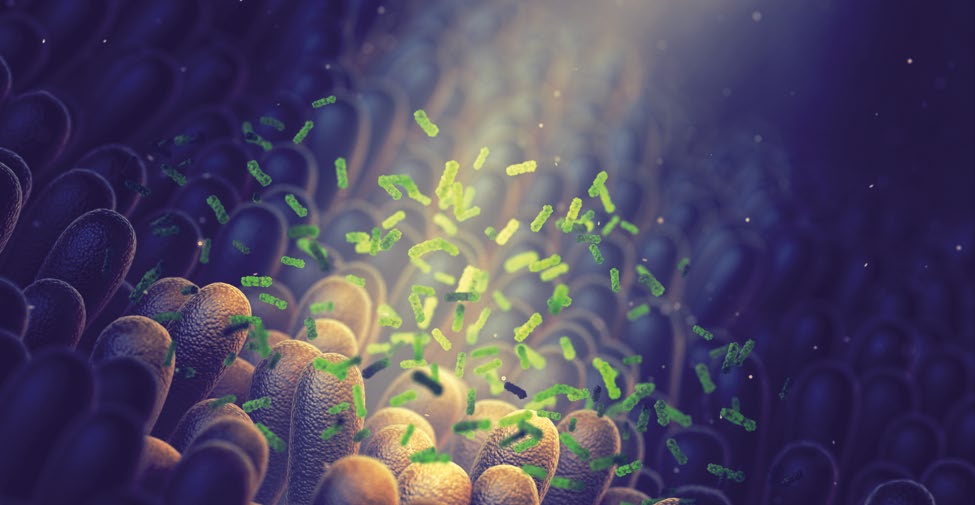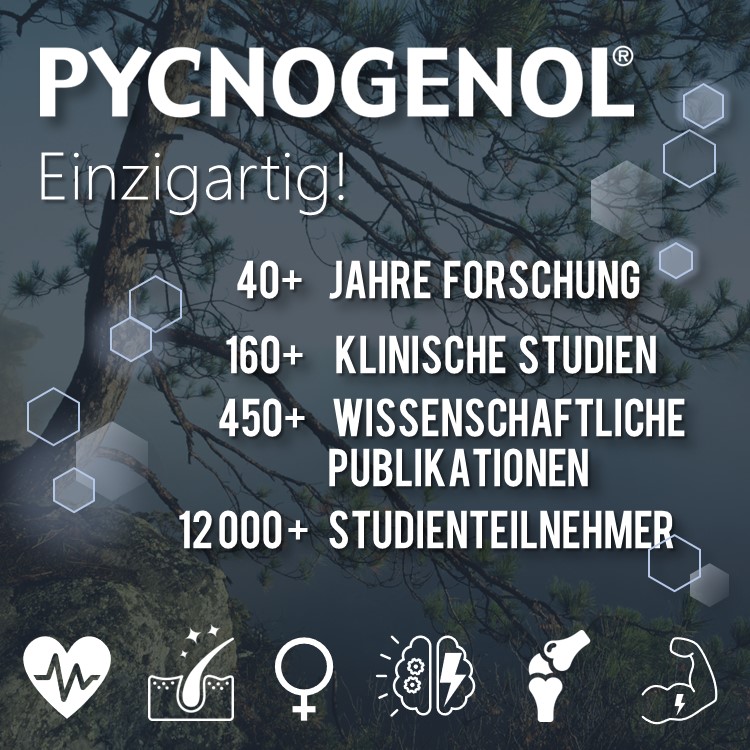Darmflora, intestinale Mikrobiota oder Darm-Mikrobiota – sie alle bezeichnen die Vielzahl an Bakterien, die in unserem Darm leben. Mehr als 1,3-mal so viele Bakterien und andere Mikroorganismen als Zellen befinden sich im menschlichen Körper und der Einfluss der kleinen Bewohner auf unseren Organismus ist vielfältig. Unter anderem verhindern sie, dass sich Krankheitserreger im Darm ausbreiten und verringern damit das Risiko für Infektionen. Außerdem tragen sie zur Funktion des Immunsystems bei, unterstützen die Aufnahme von Nährstoffen und schützen unseren Körper vor Schadstoffen aller Art (1).
Aktuell sind etwa 1.000 verschiedene Arten und mehr als 100 Billionen einzelne Bakterien bekannt. Eine gesunde Darm-Mikrobiota zeichnet sich jedoch nicht durch eine hohe Bakterienmenge, sondern durch eine hohe Diversität an insbesondere gesundheitsförderlichen (protektiven) Bakterienkulturen aus.
Die Wahl der Nahrungsmittel wirkt sich sehr stark auf die Zusammensetzung der Darm-Mikrobiota aus. Einige Forscher vermuten, dass eine Wechselwirkung besteht und die mikrobielle Besiedlung des Darms daher auch Einfluss auf unsere Lebensmittelauswahl haben könnte. Daher stellt sich die Frage, ob die Bakterien auch für das Vorkommen von Heißhunger verantwortlich sein könnten.
Da die mehr als 400 verschiedenen Arten von Bakterien in unserem Darm unterschiedliche Nährstoffe zum Überleben benötigen, entscheidet unsere tägliche Lebensmittelauswahl auch über die Bakterienbesiedlung im Darm. Manche Arten ernähren sich vorzugsweise von Kohlenhydraten, andere von fett- oder eiweißreicher Kost. Darmbakterien sind jedoch nicht komplett von der menschlichen Nahrungsmittelauswahl abhängig. Der Darm ist eng mit dem Nerven- und dem Hormonsystem verbunden und die Bakterien können darüber Heißhunger auf die Lebensmittel auslösen, von denen sie sich am besten ernähren können. Die Bakterien der Darm-Mikrobiota können über Signale und Hormone die Geschmacksnerven und den Appetit beeinflussen, um Lust auf die Lebensmittel auszulösen, die sie gerade zum Überleben benötigen. Eine Änderung des Ernährungsverhaltens kann sich bereits kurzfristig auf das Darm-Mikrobiom auswirken (2).
Darmbakterien und Botenstoffe
Wird als Antwort auf den Heißhunger der Nährstoff zugeführt, der benötigt wird, so wird über das „Glückshormon“ Dopamin ausgeschüttet und wir fühlen uns glücklich. Dieses Glücksgefühl ist jedoch nicht abhängig davon, ob die Mahlzeit gesund für uns ist oder nicht, daher kann die Beeinflussung des Essverhaltens durch die Darmbakterien auf Dauer auch ungesund werden. Langfristig entscheiden der Einfluss der Darmbakterien und damit unser Essverhalten auch über das Körpergewicht. Es konnte bereits festgestellt werden, dass bestimmte Bakterien wie Clostridium ramosum verstärkt im Darm von übergewichtigen Menschen vorkommen. In einer Studie an Mäusen konnte gezeigt werden, dass das Bakterium Clostridium ramosum im Darm der Tiere dazu führt, vermehrt enterochromaffine Zellen zu bilden. Diese Zellen produzieren den Botenstoff Serotonin, welcher dauerhaft die Anzahl der Fettsäuretransporter im Darm vermehrt und so die Entstehung von Übergewicht fördert (3).
Eine falsche Ernährung durch industrielle Lebensmittel, die viel Salz, Zucker, Fett und Zusatzstoffe enthalten, kann die Ursache für das vermehrte Vorkommen der gesundheitsschädlichen Darmbakterien sein. Auch häufiger Stress oder eine Medikamenteneinnahme können die bakterielle Besiedlung des Darms beeinträchtigen. Ist die Darm-Mikrobiota einmal ins Ungleichgewicht geraten, so haben Pilze und Parasiten ein leichtes Spiel und können sich schnell ausbreiten. Diese ernähren sich ebenso wie bestimmte Bakterien überwiegend von Zucker und schnell verwertbaren Kohlenhydraten.
Durch eine gesunde Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist, können die protektiven Darmbakterien gefördert und so einer Dysbiose entgegengewirkt werden. Die Fermentation zu kurzkettigen Fettsäuren, die den gesundheitsförderlichen Darmbakterien als Nahrung dienen, sorgt für eine vermehrte Produktion von Bifidobakterien. Diese können unsere Gesundheit maßgeblich verbessern und bedarfsgerechtes Essverhalten fördern (3).
Quelle: Vitalstoffe